* Ausschnitt letzte Seite
„Caliban über Setebos“
„Caliban über Setebos“
back next
Auch Czischkes grafische Arbeiten zeugen von seinem kreativen
Schaffensdrang. Als Beispiel seien seine „Schreibmaschinenbilder“
genannt, bei denen er die Typografie einer Schreibmaschine zur
Gestaltung sehr reduzierter grafischer Blätter mit kritischen
politischen Botschaften verbindet. Diese Beschäftigung mit dem
Verhältnis von Kunst und Schrift lässt sich nicht allein aus seiner
vorausgegangenen Tätigkeit als Schriftsetzer herleiten, sondern erweist
sich als grundsätzliches Interesse von nachhaltiger Bedeutung, das auf
mannigfaltige Weise in seinem Oeuvre sichtbar wird. Dynamisch und
diszipliniert zugleich und bar jeden gestischen Überschwangs kommt eine
andere Serie von grafischen Blättern daher. In diesen durchdringen und
verdichten sich schwarze Linien zu abstrakten Konfigurationen. Sie
verdanken ihren Entstehungsprozess der schlagenden Bewegung mit
Bleischnüren, die mit japanischen und chinesischen Sepiatuschen
präpariert waren.
Malerei, Grafik und Plastik stehen im Werk von Jörg Czischke gleichberechtigt nebeneinander. Und doch nehmen seine künstlerischen Bearbeitungen literarischer Werke eine Sonderstellung ein. Beinahe besessen hat er nach Bildsprachen als Equivalenten zur geschriebenen Sprache in der Literatur gesucht und diese gefunden. Dies gilt insbesondere für den „Caliban über Setebos“. Begonnen im Jahr 1972 und beendet in den 80er Jahren umfasst das Werk 111 Blätter, die in eine Kassette eingelegt sind. Jedes Blatt hat ein Format von 53,5 x 39,5 cm. Die einzelnen Blätter sind überreich gestaltet und ausgeführt in einem Mix unterschiedlicher Techniken, u.a. farbigen Zeichnungen und Collagen. Wiederum spielt die Schrift als bildnerischem Gestaltungsmittel eine bedeutende Rolle.
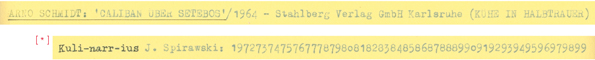
Die Inspirationsquelle für Jörg Czischkes Werk war die Erzählung „Caliban über Setebos“ von Arno Schmidt, die dieser als Kontrafaktur zum griechischen Orpheusmythos 1964 geschrieben hat. Grundlegend für Schmidts Text sind die weit reichenden Verschlüsselungen und Umformungen, die dem Leser zunächst kaum daraus Hinweise geben, in der Erzählung eine Anspielung auf den Orpheusmythos zu sehen. Die häufige Erwähnung von James Joyce mag dessen „Ulysses“ und über diesen Umweg den antiken Mythos zum Bewusstsein bringen. Auch die mythenbezogenen Namen in Schmidts Erzählung geben Hinweise. So finden sich u.a. die Namen Orpheus und Euridike in den Namen der Hauptakteure Orje und Rieke. Die Parallelität ihrer Handlungen und die anderer Personen zum antiken Mythos offenbaren sich allerdings nur allmählich, die mythologischen Bezüge in der Erzählung erweisen sich als äußerst komplex, ihre Entschlüsselung als Herausforderung.
Malerei, Grafik und Plastik stehen im Werk von Jörg Czischke gleichberechtigt nebeneinander. Und doch nehmen seine künstlerischen Bearbeitungen literarischer Werke eine Sonderstellung ein. Beinahe besessen hat er nach Bildsprachen als Equivalenten zur geschriebenen Sprache in der Literatur gesucht und diese gefunden. Dies gilt insbesondere für den „Caliban über Setebos“. Begonnen im Jahr 1972 und beendet in den 80er Jahren umfasst das Werk 111 Blätter, die in eine Kassette eingelegt sind. Jedes Blatt hat ein Format von 53,5 x 39,5 cm. Die einzelnen Blätter sind überreich gestaltet und ausgeführt in einem Mix unterschiedlicher Techniken, u.a. farbigen Zeichnungen und Collagen. Wiederum spielt die Schrift als bildnerischem Gestaltungsmittel eine bedeutende Rolle.
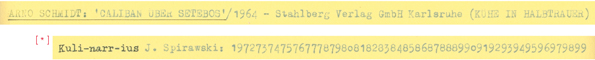
Die Inspirationsquelle für Jörg Czischkes Werk war die Erzählung „Caliban über Setebos“ von Arno Schmidt, die dieser als Kontrafaktur zum griechischen Orpheusmythos 1964 geschrieben hat. Grundlegend für Schmidts Text sind die weit reichenden Verschlüsselungen und Umformungen, die dem Leser zunächst kaum daraus Hinweise geben, in der Erzählung eine Anspielung auf den Orpheusmythos zu sehen. Die häufige Erwähnung von James Joyce mag dessen „Ulysses“ und über diesen Umweg den antiken Mythos zum Bewusstsein bringen. Auch die mythenbezogenen Namen in Schmidts Erzählung geben Hinweise. So finden sich u.a. die Namen Orpheus und Euridike in den Namen der Hauptakteure Orje und Rieke. Die Parallelität ihrer Handlungen und die anderer Personen zum antiken Mythos offenbaren sich allerdings nur allmählich, die mythologischen Bezüge in der Erzählung erweisen sich als äußerst komplex, ihre Entschlüsselung als Herausforderung.